Wie weiter mit der EU?
Thüringen: das Ende der Sozialpartnerschaft?

Wir Österreicher teilen uns mit Thüringen das Hinterwäldlertum und die Prinzessin Elisabeth. Trotzdem gibt es genug Gründe sich mit den Vorgängen im Freistaat Thüringen auseinanderzusetzen.
„Hauptsache, die Sozialisten sind weg“1
Von Jörg Goldberg, André Leisewitz
Zeitschrift Marxistische Erneuerung
Nur 25 Stunden nach seiner Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten musste FDP-Mann Thomas Kemmerich den Rücktritt ankündigen. Am Abend des 6. Februar schien das Experiment einer AfD-gestützten Landesregierung erstmal gescheitert. Für die „bürgerliche Mitte“ ist eine Kooperation mit der AfD auf Landesebene vorerst keine Option. Vorerst: Denn Bruchlinien sind unübersehbar: Am deutlichsten war der Zuspruch für Kemmerich in der FDP; in der CDU-Führung wurde die Haltung der Thüringer „Parteifreunde“ zwar mehr oder weniger heftig kritisiert, von Sanktionen gegen diese oder gegen Mitglieder der ‚Werteunion‘, die die Kemmerich-Wahl – wie die Junge Union - begrüßt hatten, war keine Rede. Offensichtlich waren die Parteiführungen von CDU und FDP schon vor der Abstimmung in Erfurt über mögliche AfD-Kooperationen informiert, waren aber nicht willens bzw. in der Lage, die absehbare Entwicklung zu stoppen.
Auch wenn bei Abfassung dieses Kommentars unklar war, wie sich die Dinge vor Ort entwickeln würden, so ist doch festzuhalten, dass der „Tabubruch“ vom 5. Februar die politische Landschaft der Bundesrepublik verändert hat: Die Einbeziehung der AfD ist nun eine mögliche Machtoption. Sie wird nicht wieder verschwinden. Die Frage ist, warum Teile von FDP und CDU bereit waren, ein solches Experiment zuzulassen, obwohl die AfD mit ihrem völkisch-nationalen Diskurs quer zur Weltmarktorientierung des deutschen Kapitals liegt.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst fällt die Unfähigkeit der Führungen im konservativen Lager ins Auge, konsistente Machtstrategien zu formulieren und durchzusetzen. Die Thüringer Ereignisse illustrieren drastisch den auf vielen Feldern konstatierten „Kontrollverlust“ (s. den Redaktionsartikel im gleichen Heft). Ein weiterer Grund dürfte sein, dass platter Antikommunismus und Antisozialismus etwas aus der Mode gekommen sind. Viele in CDU und FDP – siehe vor allem die Stellungnahme der ‚Werteunion‘ – halten dies für unverzichtbar und können nur schwer ertragen, wenn ein Linken-Ministerpräsident Friedrich Merz zufolge „bis in die Mitte hinein Sympathien genießt“. Dass in der CDU eine wenn auch nur punktuelle Kooperation mit einer von Ramelow geführten Landesregierung nicht ausgeschlossen wird, wurde von Einigen als eigentlicher „Dammbruch“ empfunden. Vieles spricht dafür, dass die in Thüringen einflussreiche CDU-Rechte, die schon lange auf Zusammengehen mit der AfD orientiert (dafür stehen u.a. die Namen Maaßen und Vera Lengsfeld) die Berliner Parteiführung, d.h. AKK und Merkel, desavouieren wollte. Thüringen ist der erste Versuch, zu einer politischen Neuformierung des rechten Blocks unter Einbeziehung der AfD zu kommen. Überraschend ist dabei nur das Tempo, die Missachtung historischer Faktoren (vor 90 Jahren wurde in Thüringen der erste NSDAP-Minister etabliert) und die Schamlosigkeit, dies zusammen mit dem erklärten Faschisten und Geschichtsrevisionisten Höcke umzusetzen.
Schließlich verstehen sich CDU, FDP und AfD als Eigentumsparteien – die Verteidigung des Privateigentums ist die DNA der „bürgerlichen Mitte“. Obwohl diese Grundlage des Kapitalismus gegenwärtig nirgendwo ernsthaft in Frage gestellt wird, gelten im „bürgerlichen“ Lager Debatten, die punktuelle Beschränkungen der Eigentumsrechte nicht ausschließen, als alarmierend, wobei schon die Deckelung von Renditen und progressive Steuern als Eingriff ins Privateigentum empfunden werden „Der Schutz des Eigentums ist ein hoher grundgesetzlicher Schutz – den dürfen wir nicht untergraben oder irgendwie in Frage stellen“ hatte Thomas L. Kemmerich am 9. April 2019 zur „aktuellen Enteignungsdebatte“ erklärt. Das meinte auch Friedrich Merz, als er am 22. September in der „Welt“ behauptete, die Klimabewegung sei der Versuch der „Zerstörung der marktwirtschaftlichen Ordnung“. Dass die FDP bei der Einbeziehung der AfD in den herrschenden Block voranprescht, kann nicht überraschen. Beide Parteien haben die gleichen Wurzeln. Die FDP stützt sich – wie die AfD – wahlpolitisch stark auf Selbständige und mittelständische Kapitalfraktionen, die am ehesten in Panik geraten, wenn sie das Privateigentum bedroht glauben. Kemmerich, als Eigner einer Friseurkette idealtypischer Repräsentant dieser Fraktion, machte im Gespräch mit Marietta Slomka am 6. Februar nochmal deutlich, dass es für ihn „auch gegen linke radikalistische Forderungen, Enteignungsfantasien …“ geht.
Für die linke Seite des politischen Spektrums, einschließlich SPD und Grüne, muss Thüringen ein Weckruf sein: Wenn sich die Möglichkeit bietet, werden die „bürgerlichen“ Parteien selbst gemäßigt reformistischen Konstellationen eine politische Blockbildung vorziehen, die die Garantie bietet, dass das Privateigentum nicht „irgendwie in Frage gestellt“ wird. Alle anderen strategischen Ziele des Kapitals sind nachrangig, wenn (nach Ansicht der „bürgerlichen Mitte“) das Eigentum zur Debatte gestellt wird. Der Linkspartei wurde demonstriert, dass die Hoffnung, durch historische ‚Kompromisse‘ („DDR-Unrechtsstaat“), ‚bürgerliches‘ Wohlverhalten und den Appell an den ‚demokratischen Konsens‘ CDU und FDP zu wenigstens korrektem Verhalten gegenüber linken Konstellationen zu bewegen, völlig illusionär ist. Und jetzt steht die Erfurter Koalition aus Linkspartei, SPD und Grünen vor dem Problem – wenn es nicht zu Neuwahlen kommt – sich von zwei Parteien „tolerieren“ zu lassen oder punktuell mit ihnen zusammenzuarbeiten, die eben noch mit der AfD gegen sie intrigierten. Schöne Aussichten …
Jörg Goldberg/André Leisewitz
1 Hans-Georg Maaßen zur Wahl von Kemmerich. (Dieser Kommentar wurde nach Red. Schluss am 7.2.20 verfasst.)
Warum Thüringen - schon wieder?
Coup der AfD weckt Erinnerungen
Aus "Die Presse", von Anneliese Rohrer
Erstaunlich, dass keiner der Freunde oder Gäste aus Deutschland eine Antwort wusste: Vielleicht aus Desinteresse, vielleicht aus Unkenntnis der eigenen Geschichte. Seit der Sensation im Bundesland Thüringen wird es jetzt wohl anders sein.
Die Fragen waren: Wisst ihr, dass Hitlers Aufstieg in Thüringen begann, wo er als Beamter eingebürgert hätte werden sollen? Nein, nicht gewusst, nicht gehört. Das verwundert. Bereits im Februar 2000 hatte die Wochenzeitschrift „Die Zeit" ausführlich die Vorgänge in „Thüringen 1930 - Bürger Hitler" beschrieben; im Jänner 2018 widmete sich der Journalist Tom Fugmann bei „MDR Zeitreise" der „Machtergreifung in der Mitte Deutschlands" und dem „Mustergau Thüringen".
Die jetzige Aufregung um die Wahl eines Ministerpräsidenten der liberalen FDP von Gnaden der Alternative für Deutschland (AfD) und ihres Landesvorsitzenden Björn Höcke, den man straffrei als Faschisten bezeichnen darf, ist nur vor dem Hintergrund der kollektiven Vergesslichkeit zu verstehen.
Nach der Landtagswahl in Thüringen 1929 war die NSDAP Zünglein an der Waage, erschien den bürgerlichen Parteien eine Koalition mit einer rechtsextremen Bewegung vorteilhafter als eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten. Auch damals hingen manche der Illusion an, man werde die radikale Partei schon für eine verantwortungsbewusste Mitarbeit gewinnen können - ihr die Radikalität austreiben. Welch ein Irrtum! Kommt das bekannt vor?
Was aber ist dann der Unterschied zu heute? Der Thüringer CDU wurde von der Parteizentrale eine Zusammenarbeit mit den Linken untersagt. Nur, um jetzt in die Falle des rechtsextremen „Flügels" der AfD zu tappen. Hätte sich die CDU dem Veto der Bundespartei Richtung links widersetzt, hätte sie die CDU-Führung zwar auch blamiert, aber nicht im gleichen Ausmaß wie jetzt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat eben Erfurt auch mit erheblichem Gesichts- und politischem Gewichtsverlust verlassen.
Wenn's nicht so abgedroschen wäre, müsste man jetzt an Bruno Kreisky erinnern: ,,Lernen Sie Geschichte ... " Es muss ja nicht so drastisch formuliert werden wie in der „MDR Zeitreise", aber man kann es auch nicht verdrängen:
„Vieles von dem, was nach der Machtergreifung 1933 in ganz Deutschland geschehen würde, war zuvor in Thüringen erdacht und erprobt worden;"
Man sollte es vor allem auch deshalb nicht verdrängen, weil Björn Höcke nach dem fulminanten Zugewinn bei der Landtagswahl im Oktober 2019 von 10,6 Prozent (2014) auf 23,4 Prozent als zweitstärkste Kraft ganz ähnliche Töne anschlug. Zuerst die Stärke der AfD im Osten Deutschlands, dann der Umbau der West-Landesparteien, meinte er sinngemäß nach der Wahl 2019, wobei sich die anderen Parteien ganz ähnlich hilflos und kraftlos geben wie 1933.
Die zweite Frage lautete: Warum Thüringen - schon wieder? Immerhin brachte es die NSDAP dort bereits 1929 zur ersten Regierungsbeteiligung in Deutschland überhaupt und 1932 auf 42 Prozent der Stimmen.
Ganz selten und ganz beiläufig ließen sich für die Landtagswahl im Oktober und die „Sensation von Erfurt" jetzt einige Erklärungen finden unbefriedigend allesamt. Das Bundesland sei immer schon national gesinnt gewesen, eine von der Geschichte her nicht besonders originelle Erklärung. Aus diesem Grund war Thüringen von der NSDAP ja als „Experimentierfeld" ausgesucht worden.
Interessanter sind da schon andere Parallelen. Historiker begründen den Zulauf zu den Nationalsozialisten damals so: Kleinbürgerliche Wähler, eher links gestimmt, litten in Zeiten der Wirtschaftskrise unter starken Verlustängsten. Ein historischer Protestwille gegen die „Republik" lässt sich auch vermuten. Es könnte helfen, an diese Zusammenhänge zu denken, damit aus dem Tabubruch in Erfurt nicht ein Super-GAU in Berlin wird.
Anneliese Rohrer ist Journalistin in Wien.
diepresse.corn/rohrer
Interview mit Carlo Galli, Bologna
Interview aus dem Kleinen Zeitung vom Sonntag 9. Februar 2020
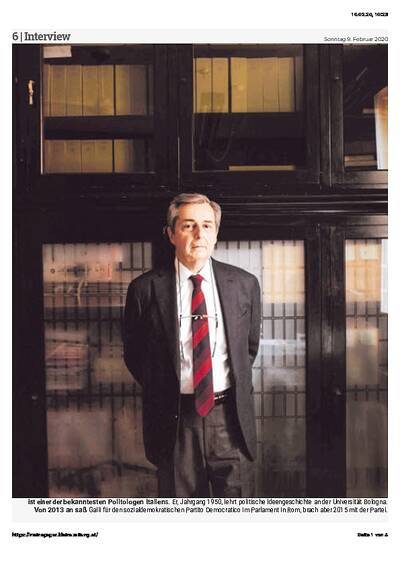
Von Stefan Winkler aus der Kleinen Zeitung, 9.2.2020
Carlo Galli ist einer der bekanntesten Politologen Italiens. Er, Jahrgang 1950, lehrt politische Ideengeschichte an der Universität Bologna.
„Vor dem Euro waren wir alle sehr europäisch“
INTERVIEW. Zerrissene Gesellschaften, eine kaputte Infrastruktur und eine gefährlich ge-schwächte Demokratie: Der italienische Politologe und frühere Linkspolitiker Carlo Galli zeichnet ein düsteres Bild von Europa.
Herr Galli, ein Linker, der im vom Brexit gebeutelten vereinten Europa das Banner der Souveränität hochhält, das hat etwas. Das riecht nach Häresie. Sehen Sie sich selbst als Ketzer?
CARLO GALLI: Ich warte auf das Urteil der Heiligen Inquisition. Aber Spaß beiseite! Tatsächlich scheint es unter den politisch korrekt gebürsteten Mainstream-Eliten einen Imperativ zu geben: Verachtet die Souveränität, verspottet sie! Wer positiven Gebrauch von dem macht, was jahrhundertelang das Herz der Staatslehre war, gilt heute als Höhlenbewohner. Man bedenkt ihn mit einem mitleidigen Lächeln wie jemanden, der mit einem Münztelefon telefoniert, oder dämonisiert ihn als Faschisten. Souveränität wird als Tribalismus abgetan, als Nostalgie und Rassismus. Nach ihr zu streben, gilt als böse!
Was halten Sie dem entgegen?
Die Souveränität ist eines der fundamentalen politischen Konzepte, auf denen unsere modernen Staaten gründen, und ist bis heute in vielen Verfassungen in Europa verankert. Wer das nicht begreift, versteht gar nichts! Die Souveränität ist als Idee sehr alt. In ihrer heutigen, demokratischen Form ist sie aber ein Kind des neuzeitlichen Rationalismus und der Französischen Revolution, die sie dem König genommen und dem Volk gegeben hat. Hobbes, Hume, Rousseau sprachen von ihr. Souveränität ist das Faktum, dass ein Volk politisches Subjekt sein will in der Geschichte, dass es selber über sich entscheiden, sich eine Ordnung geben will. „We the people“ lautet der berühmte Anfang der amerikanischen Verfassung von 1787.
Dagegen ist schwer etwas einzuwenden. Warum ist Souveränität in Europa so verrufen?
Weil sie bestimmten Interessen zuwiderläuft. Die wahren Feinde der Souveränität sind seit jeher universalistische Mächte, allen voran die Wirtschaft. Die Berufung des Kapitalismus ist global. Sie ist das, was wir Globalisierung nennen. Wenn ein Weltkonzern sich vor etwas fürchtet, so ist das eine politische Macht, die ihn hindert, zu tun, was er will. Und dann steht die Souveränität natürlich auch dem Bestreben entgegen, in Europa ein supranationales, politisches System zu errichten. Viele glauben ja, dass die Souveränität zugunsten der EU überwunden werden müsse. Aber die EU ist halt kein souveränes Subjekt.
Was ist sie dann?
Nichts, die EU ist politisch ein Nichts. Das bekommen wir täglich vor Augen geführt, in Libyen, in Sy-rien. Europa ist auf der internationalen Bühne handlungsunfähig, weil es gar kein eigenständiger souveräner Akteur sein will. Die wahre Macht in der EU geht von den Mitgliedstaaten aus, von denen zwar einige für den Euro auf ihre Währungshoheit verzichtet, aber sich alle anderen zentralen souveränen Rechte bewahrt haben. All das Gerede von einem supranationalen Europa ist Lüge. Tatsächlich gibt es einen Tisch, an dem die Vertreter der einzelnen Staaten sitzen und verhandeln. Und der Stärks-te gewinnt.
Wollen Sie damit sagen, die Europäer gaukeln sich etwas vor?
Kanzlerin Merkel macht sich keine Illusionen über eine europäische Souveränität. Sie weiß genau, dass Deutschland ein souveräner Staat ist, und handelt auch so. Auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vertritt die Auffassung, dass das Bauprinzip der EU die Subsidiarität ist unter Berücksichti-gung der deutschen Verfassung. Das heißt im Klartext, die europäischen Institutionen sind in Berlin solange willkommen, wie sie Deutschland zugestehen, die Dinge am besten zu erledigen. Sobald sie aber Deutschland daran hindern, seinen Pflichten gegenüber sich selbst nachzukommen, gelten sie nichts. Dasselbe gilt für Frankreich. Wenn Frankreich an Europa denkt, denkt es an eine Union, an deren Schlüsselstellen Franzosen sitzen.
Allein kann selbst Frankreich in der Welt von heute kaum bestehen. Spricht das nicht dafür, die nationalen Souveränitäten in einer europäischen aufgehen zu lassen?
Um das zu realisieren, müssten Macron und Merkel zustimmen, dass Deutschland und Frankreich auf einer Stufe mit Texas und Illinois rangieren. Tatsächlich bräuchte es dafür eine Revolution. Aber ich gebe Ihnen recht. Ein Staat mittlerer Größe wird es schwer allein mit Amazon aufnehmen können.
Also braucht es die EU ja doch!
Ich könnte mir auch gut ein nur unter dem Banner gegenseitiger Wirtschaftshilfe geeintes Europa vorstellen. Ich meine, wir alle waren vor dem Euro doch sehr europäisch gesinnt. Sicher, es gab solche, die mehr verdienten und andere, die weniger hatten. Aber die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hat funktioniert und war nützlich. Das wahre Problem kam erst mit dem Euro, mit dem Europa eine neue ökonomische Ordnung erhalten hat, den deutschen Ordoliberalismus. Dieser hat die Inflation zum Hauptfeind mit der Folge, dass, weil man das Geld nicht mehr abwerten kann, die Arbeit entwertet und rechtlich ausgehöhlt wird. Zudem lässt dieses Wirtschaftsmodell die sozialen Ungleichheiten wachsen. Das führt in den Euroländern dazu, dass Massen Benachteiligter den Staat um Schutz bitten. Doch statt in der Krise diesen Schutz zu geben, hat die EU mit Austerität geantwortet.
Eine Strenge, die in Spanien, Irland und sogar Griechenland inzwischen positive Früchte trägt.
Das sagt man. Aber was ist der Preis dafür? Die Gesellschaften dieser Länder sind zerrissen. In Italien stürzen die Brücken ein und die Demokratie ist geschwächt. In Frankreich gibt es jeden Samstag Bürgerkrieg, und überall in Europa schießen die Protestparteien empor.
Der Euro als Wurzel allen Übels. Ist das bei dem Schuldenberg, auf dem Italien sitzt, nicht wohlfeil?
Es stimmt, dass nicht alle Probleme Italiens auf den Euro zurückgehen. Aber der Euro akzentuiert sie und spaltet das Land. Italiens Schulden zählen da wenig. Der entscheidende Punkt ist, dass der Staat nicht genug Mittel für die notwendigen Investitionen hat und jedes Jahr noch tiefer schneiden muss. Das erzeugt Dynamiken, und eine Dynamik könnte sein, dass Italien eines Tages Großbritannien folgt und die EU verlässt, auch wenn heute keine politische Kraft im Land den Ausstieg aus der Eurozone will.
Pardon, Sie reden wie Salvini.
Salvini ist ein rechter Populist. Aber der Souveränismus, auf dessen Boden er agiert, ist Ausdruck einer tiefen Unzufriedenheit, eines von vielen Ängsten gespeisten Unmuts, der eine böse Wendung nehmen kann. Nur das zählt. Wenn man daher gegen Salvini Politik machen will, was ist besser? Dass man ihn und seine Wähler Faschisten heißt, oder dass man zu begreifen sucht, was da geschieht?
Wäre ein Austritt Italiens das Ende der Europäischen Union?
Europa würde endgültig zum deutsch-französischen Projekt. Das heißt, Deutschland hat in Wahrheit das Kommando. Es hat kapiert, dass es Frankreich nicht bekriegen, sondern nur gut behandeln muss. Es verlangt ihm nicht die Opfer ab, die es von Italien fordert, das wie ein Fisch am Haken zappelt. England ist dem entkommen, und euch Österreichern wird es in dieser EU nicht schlecht gehen. Schließlich seid ihr voll in die deutsche Wirtschaft integriert. Aber euch muss klar sein, dass so ein Europa kein souveränes Gebilde wäre, sondern ein Machtsystem, das – obschon friedfertig – von Berlin beherrscht wird. Aber auch Deutschland gleitet in eine Wirtschaftskrise, was Prognosen über die Zukunft der EU schwierig macht.
Veröffentlicht: 11. Februar 2020
